Readings Newsletter
Become a Readings Member to make your shopping experience even easier.
Sign in or sign up for free!
You’re not far away from qualifying for FREE standard shipping within Australia
You’ve qualified for FREE standard shipping within Australia
The cart is loading…

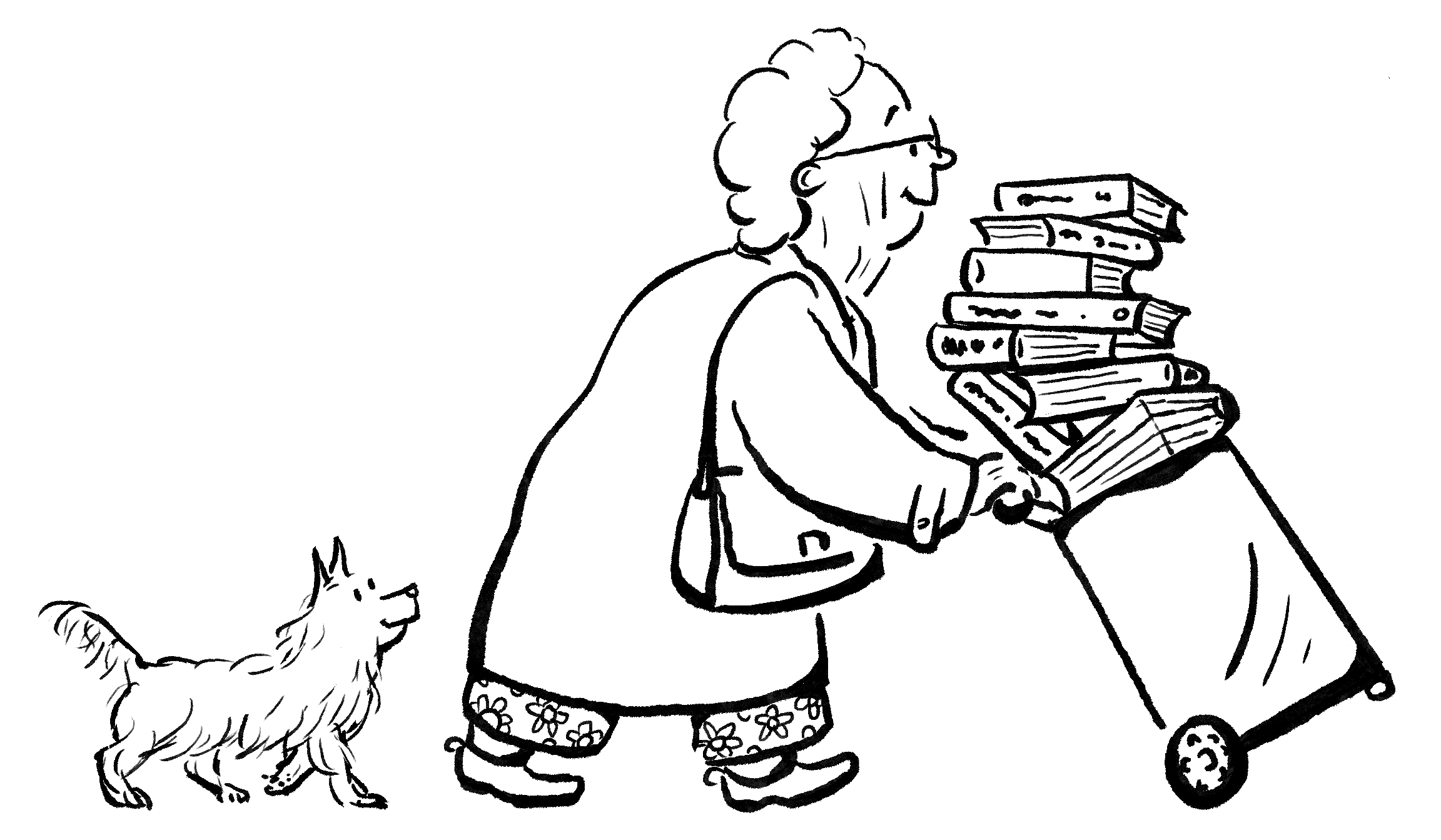




Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Philosophie - Philosophie des 20. Jahrhunderts / Gegenwart, Note: 1, Karl-Franzens-Universitat Graz (Geschichte), Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit stellt das Denken und die Person Fritz Mauthners in einen historischen Kontext. Zum einen gibt es seit den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts in der gesamten westlichen Welt ein Phanomen, das als Sprachkrise beschrieben werden kann. Intellektuelle, Schriftsteller und Philosophen entdecken die Kluft zwischen der Welt und dem Wort, es entsteht der Eindruck, als wurde die Sprache die Wirklichkeit nicht mehr erfassen. Zum anderen lasst sich im zentraleuropaischen Raum, in dem Gebiet der ehemaligen Habsburgermonarchie, seit den Jahrzehnten um die Jahrhundertwende ein vermehrtes und verstarktes Interesse an der Sprache feststellen. Dieses Interesse an der Sprache, ihrem Wesen und ihren Funktionen, lasst sich in den Werken Robert Musils, Fritz Mauthners, Franz Kafkas, Hugo von Hofmannsthals, Ludwig Wittgensteins, Moriz Schlicks und Karl Kraus’ - um nur einige zu nennen - vermehrt und sehr fruh feststellen. Daher kann man annehmen, die Artikulation und die Aufmerksamkeit der Intellektuellen in der Habsburgermonarchie ist durch ein bestimmtes, sprachskeptisches Klima im vielsprachigen, pluralistischen und kulturell heterogenen Zentraleuropa begunstigt worden. Dieses Klima ist vor allem in den urbanen Ballungszentren wie Wien oder Prag besonders dicht. Fritz Mauthner, in Bohmen geboren und in Prag aufgewachsen, eignet besonders gut, um das sprachskeptische Klima der Monarchie sowie die Sprachkrise allgemein darzustellen. Die ersten drei Teile der Arbeit verorten Mauthner zunachst in der philosophischen Tradition der abendlandischen Sprachkritik und dann im soziokulturellen Kontext der Monarchie. Der vierte Teil der Arbeit zeichnet dann in drei Schritten die Genese des sprachkritischen Klimas in der Monarchie um die Jahrhundertwende nach. Dabei hat auch die Reformation und in we
$9.00 standard shipping within Australia
FREE standard shipping within Australia for orders over $100.00
Express & International shipping calculated at checkout
Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Philosophie - Philosophie des 20. Jahrhunderts / Gegenwart, Note: 1, Karl-Franzens-Universitat Graz (Geschichte), Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit stellt das Denken und die Person Fritz Mauthners in einen historischen Kontext. Zum einen gibt es seit den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts in der gesamten westlichen Welt ein Phanomen, das als Sprachkrise beschrieben werden kann. Intellektuelle, Schriftsteller und Philosophen entdecken die Kluft zwischen der Welt und dem Wort, es entsteht der Eindruck, als wurde die Sprache die Wirklichkeit nicht mehr erfassen. Zum anderen lasst sich im zentraleuropaischen Raum, in dem Gebiet der ehemaligen Habsburgermonarchie, seit den Jahrzehnten um die Jahrhundertwende ein vermehrtes und verstarktes Interesse an der Sprache feststellen. Dieses Interesse an der Sprache, ihrem Wesen und ihren Funktionen, lasst sich in den Werken Robert Musils, Fritz Mauthners, Franz Kafkas, Hugo von Hofmannsthals, Ludwig Wittgensteins, Moriz Schlicks und Karl Kraus’ - um nur einige zu nennen - vermehrt und sehr fruh feststellen. Daher kann man annehmen, die Artikulation und die Aufmerksamkeit der Intellektuellen in der Habsburgermonarchie ist durch ein bestimmtes, sprachskeptisches Klima im vielsprachigen, pluralistischen und kulturell heterogenen Zentraleuropa begunstigt worden. Dieses Klima ist vor allem in den urbanen Ballungszentren wie Wien oder Prag besonders dicht. Fritz Mauthner, in Bohmen geboren und in Prag aufgewachsen, eignet besonders gut, um das sprachskeptische Klima der Monarchie sowie die Sprachkrise allgemein darzustellen. Die ersten drei Teile der Arbeit verorten Mauthner zunachst in der philosophischen Tradition der abendlandischen Sprachkritik und dann im soziokulturellen Kontext der Monarchie. Der vierte Teil der Arbeit zeichnet dann in drei Schritten die Genese des sprachkritischen Klimas in der Monarchie um die Jahrhundertwende nach. Dabei hat auch die Reformation und in we