Readings Newsletter
Become a Readings Member to make your shopping experience even easier.
Sign in or sign up for free!
You’re not far away from qualifying for FREE standard shipping within Australia
You’ve qualified for FREE standard shipping within Australia
The cart is loading…

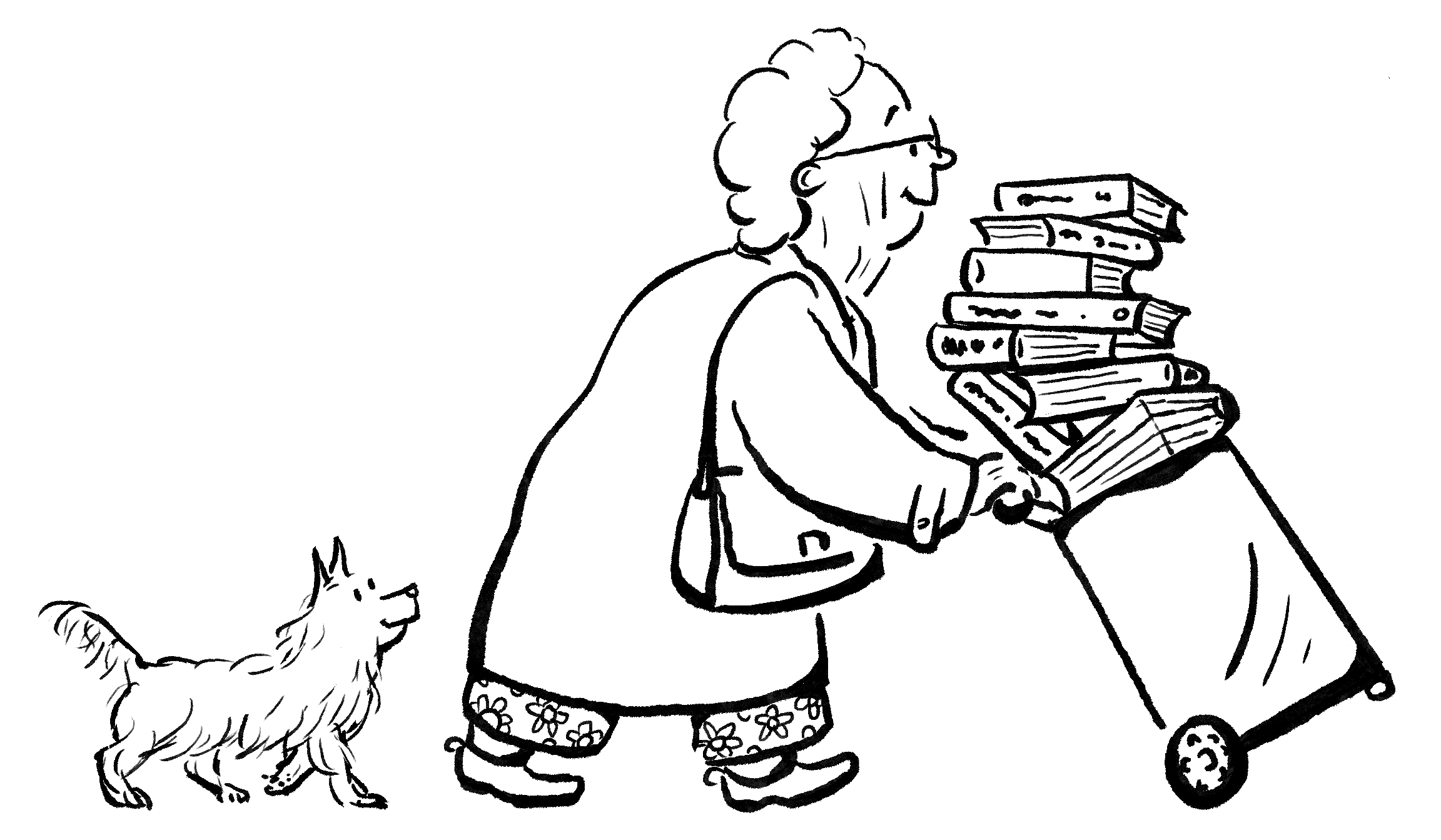



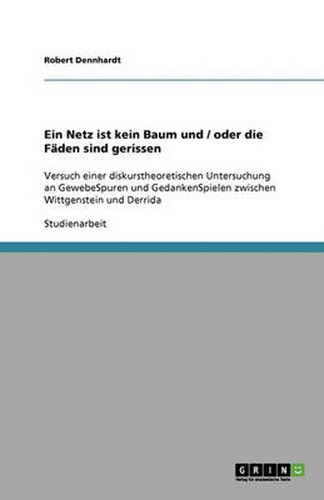
Studienarbeit aus dem Jahr 2000 im Fachbereich Philosophie - Philosophie des 20. Jahrhunderts / Gegenwart, Note: 2,0, Humboldt-Universitat zu Berlin (Kulturwissenschaft/AEsthetik), Sprache: Deutsch, Abstract: Im ersten Teil sei der Versuch unternommen, einen metaphorologischen UEbergang nachzuzeichnen als Folge eines epistemologisch-methodischen Bruchs im Denken Wittgensteins. Einen ersten Hinweis auf das Misstrauen seiner Worte und Begriffe im Tractatus gegenuber dem Sprechen seines Textes als ein Netz oder Labyrinth (Eco) gibt Wittgenstein in seinem 1945 geschriebenen Vorwort zu den Philosophischen Untersuchungen, und eine Vermutung uber den Stil des Philosophierens uberhaupt wagte er schliesslich als Notiz zu seinen Untersuchungen: Philosophie durfte man eigentlich nur dichten. Daraus muss sich, scheint mir, ergeben, wie weit mein Denken der Gegenwart, Zukunft oder Vergangenheit angehoert: Denn ich habe mich damit auch als einen bekannt, der nicht ganz kann, was er zu koennen glaubt. (Wittgenstein) Der zweite Teil wird versuchen, die verfuhrerische und scheinbar universale Macht der geometrisch-topologischen Metaphern bei Derrida aufzuzeigen. In diesem Zusammenhang nahere ich mich einem zentralen Problemfeld in Derridas Denken und Schaffen. Von Philosophen und Literaturwissenschaftlern gleichermassen vorgeworfen wird ihm vor allem diskurstheoretische Beliebigkeit und interpretatorische Willkur. Als eine Hauptursache dafur sei Derridas Verwendung von topologisch kongruenten Metaphern bezuglich jeder diskursiven Skalierung als metaphorologische Selbstahnlichkeit herausgearbeitet. Damit lehnt er vor allem jede traditionell-philosophische Rede ab, die sich ausschliesslich entlang der diskursiven Lineariat einer Ordnung von Begrundungen verschiebt. (Derrida) Eine entscheidende strategische Ursache ist, dass Derrida nach Levi-Strauss vor allem auf die identisch-zentalen Episteme der klassischen wissenschaftlichen oder philosophischen Diskurse verzichten moechte: Im Gegensa
$9.00 standard shipping within Australia
FREE standard shipping within Australia for orders over $100.00
Express & International shipping calculated at checkout
Studienarbeit aus dem Jahr 2000 im Fachbereich Philosophie - Philosophie des 20. Jahrhunderts / Gegenwart, Note: 2,0, Humboldt-Universitat zu Berlin (Kulturwissenschaft/AEsthetik), Sprache: Deutsch, Abstract: Im ersten Teil sei der Versuch unternommen, einen metaphorologischen UEbergang nachzuzeichnen als Folge eines epistemologisch-methodischen Bruchs im Denken Wittgensteins. Einen ersten Hinweis auf das Misstrauen seiner Worte und Begriffe im Tractatus gegenuber dem Sprechen seines Textes als ein Netz oder Labyrinth (Eco) gibt Wittgenstein in seinem 1945 geschriebenen Vorwort zu den Philosophischen Untersuchungen, und eine Vermutung uber den Stil des Philosophierens uberhaupt wagte er schliesslich als Notiz zu seinen Untersuchungen: Philosophie durfte man eigentlich nur dichten. Daraus muss sich, scheint mir, ergeben, wie weit mein Denken der Gegenwart, Zukunft oder Vergangenheit angehoert: Denn ich habe mich damit auch als einen bekannt, der nicht ganz kann, was er zu koennen glaubt. (Wittgenstein) Der zweite Teil wird versuchen, die verfuhrerische und scheinbar universale Macht der geometrisch-topologischen Metaphern bei Derrida aufzuzeigen. In diesem Zusammenhang nahere ich mich einem zentralen Problemfeld in Derridas Denken und Schaffen. Von Philosophen und Literaturwissenschaftlern gleichermassen vorgeworfen wird ihm vor allem diskurstheoretische Beliebigkeit und interpretatorische Willkur. Als eine Hauptursache dafur sei Derridas Verwendung von topologisch kongruenten Metaphern bezuglich jeder diskursiven Skalierung als metaphorologische Selbstahnlichkeit herausgearbeitet. Damit lehnt er vor allem jede traditionell-philosophische Rede ab, die sich ausschliesslich entlang der diskursiven Lineariat einer Ordnung von Begrundungen verschiebt. (Derrida) Eine entscheidende strategische Ursache ist, dass Derrida nach Levi-Strauss vor allem auf die identisch-zentalen Episteme der klassischen wissenschaftlichen oder philosophischen Diskurse verzichten moechte: Im Gegensa