Readings Newsletter
Become a Readings Member to make your shopping experience even easier.
Sign in or sign up for free!
You’re not far away from qualifying for FREE standard shipping within Australia
You’ve qualified for FREE standard shipping within Australia
The cart is loading…

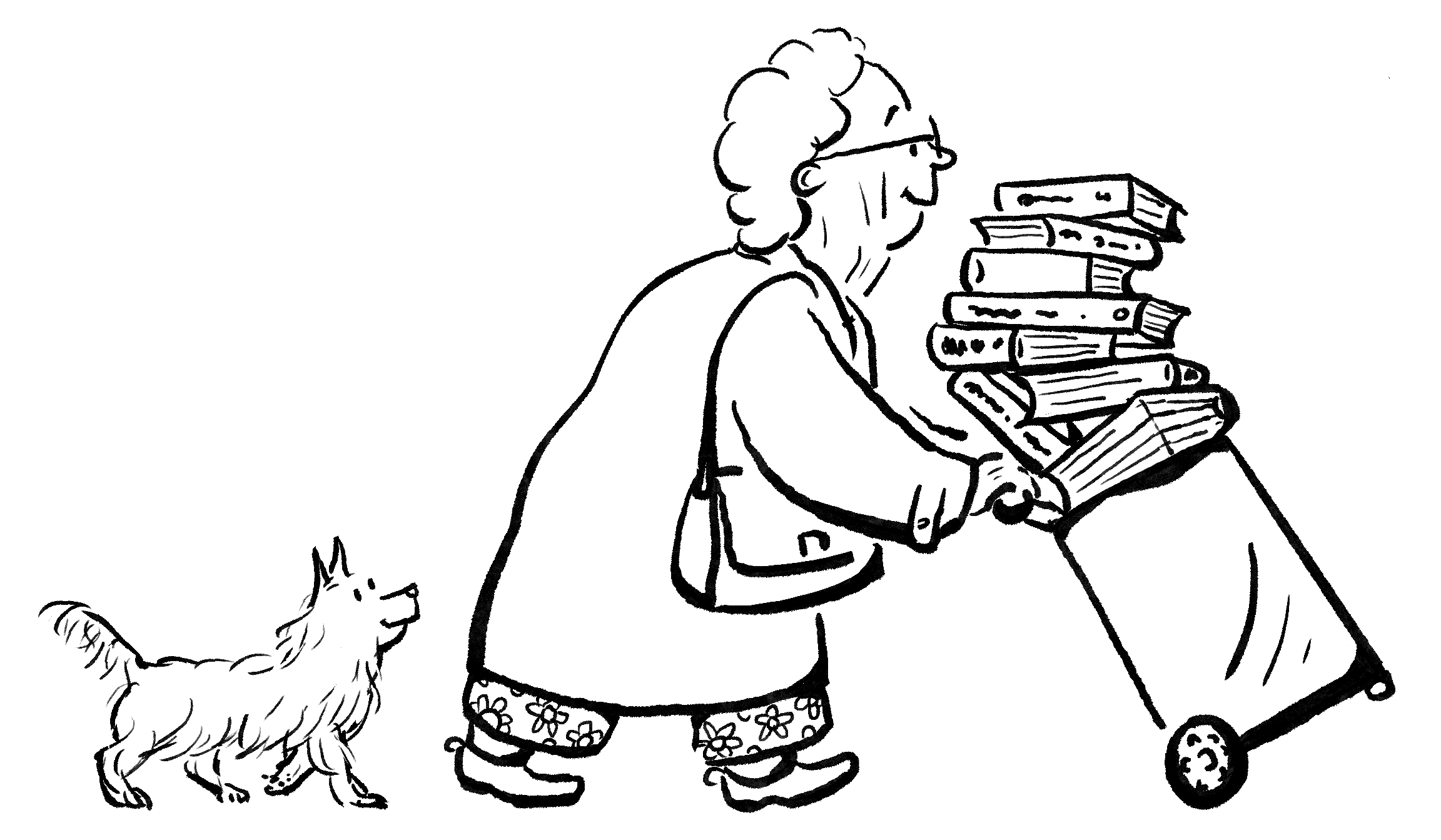




Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: 1,3, Universitat Potsdam (Institut fur Germanistik), 16 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit beschaftigt sich mit der 1924 erschienen Monolognovelle Fraulein Else von Arthur Schnitzler. Ausgehend von der Entstehungsgeschichte der Hysterie und dem Hysteriebegriff bei Freud sowie dem Aufzeigen des gesellschaftlich-sozialen Nutzen des frauenspezifischen Krankheitsbildes par excellence im 19. Jahrhundert, soll untersucht werden, wie die hysterische Erkrankung in Schnitzlers Fraulein Else konstruiert und dargestellt wird und welche Funktion dem zugesprochen werden kann. Auf der Suche nach Beispielen von hysterischen Erkrankungen in der Literatur der Jahrhundertwende uberraschte mich die Entdeckung, dass es anscheinend keine eindeutige Darstellung einer so zu bezeichnenden Hysterie mit ausfuhrlich beschriebenen motorischen Stoerungen, wie Lahmungen, zu finden ist. Die hysterisch anmutenden Symptombilder sind in der literarischen Darstellung primar auf innerpsychische Vorgange beschrankt. So auch die der Fraulein Else. Fur die Darstellung dieser Erzahlung nutzte Schnitzler die konsequent durchgehaltene Figurenperspektive des inneren Monologs1. Die psychische Verfassung der Protagonistin wird von ausseren Ereignissen beeinflusst, aber vor allem durch ihre Assoziationen vermittelt. Diese speisen sich aus ausserlich vermittelten und aus innerpsychischen Elementen, wie ihren Erinnerungen, Wunschen und Sehnsuchten. Diese gewahlte Erzahlhaltung sowie die Wichtigkeit von Traumen bzw. Phantasien ruckt Schnitzlers Text in eine enge Beziehung zur Psychoanalyse Freuds. Die gesellschaftliche Dimension der Erzahlung ist bezeichnend. Es handelt sich hierbei um das Milieu des Wiener Grossburgertums, in dem Scheinwelt und Realitat auseinanderklaffen. Obwohl alle von der bruchigen Fassade wissen, die Wiener burgerliche Gesellschaft der Jahrhundertwende s
$9.00 standard shipping within Australia
FREE standard shipping within Australia for orders over $100.00
Express & International shipping calculated at checkout
Stock availability can be subject to change without notice. We recommend calling the shop or contacting our online team to check availability of low stock items. Please see our Shopping Online page for more details.
Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: 1,3, Universitat Potsdam (Institut fur Germanistik), 16 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit beschaftigt sich mit der 1924 erschienen Monolognovelle Fraulein Else von Arthur Schnitzler. Ausgehend von der Entstehungsgeschichte der Hysterie und dem Hysteriebegriff bei Freud sowie dem Aufzeigen des gesellschaftlich-sozialen Nutzen des frauenspezifischen Krankheitsbildes par excellence im 19. Jahrhundert, soll untersucht werden, wie die hysterische Erkrankung in Schnitzlers Fraulein Else konstruiert und dargestellt wird und welche Funktion dem zugesprochen werden kann. Auf der Suche nach Beispielen von hysterischen Erkrankungen in der Literatur der Jahrhundertwende uberraschte mich die Entdeckung, dass es anscheinend keine eindeutige Darstellung einer so zu bezeichnenden Hysterie mit ausfuhrlich beschriebenen motorischen Stoerungen, wie Lahmungen, zu finden ist. Die hysterisch anmutenden Symptombilder sind in der literarischen Darstellung primar auf innerpsychische Vorgange beschrankt. So auch die der Fraulein Else. Fur die Darstellung dieser Erzahlung nutzte Schnitzler die konsequent durchgehaltene Figurenperspektive des inneren Monologs1. Die psychische Verfassung der Protagonistin wird von ausseren Ereignissen beeinflusst, aber vor allem durch ihre Assoziationen vermittelt. Diese speisen sich aus ausserlich vermittelten und aus innerpsychischen Elementen, wie ihren Erinnerungen, Wunschen und Sehnsuchten. Diese gewahlte Erzahlhaltung sowie die Wichtigkeit von Traumen bzw. Phantasien ruckt Schnitzlers Text in eine enge Beziehung zur Psychoanalyse Freuds. Die gesellschaftliche Dimension der Erzahlung ist bezeichnend. Es handelt sich hierbei um das Milieu des Wiener Grossburgertums, in dem Scheinwelt und Realitat auseinanderklaffen. Obwohl alle von der bruchigen Fassade wissen, die Wiener burgerliche Gesellschaft der Jahrhundertwende s