Readings Newsletter
Become a Readings Member to make your shopping experience even easier.
Sign in or sign up for free!
You’re not far away from qualifying for FREE standard shipping within Australia
You’ve qualified for FREE standard shipping within Australia
The cart is loading…

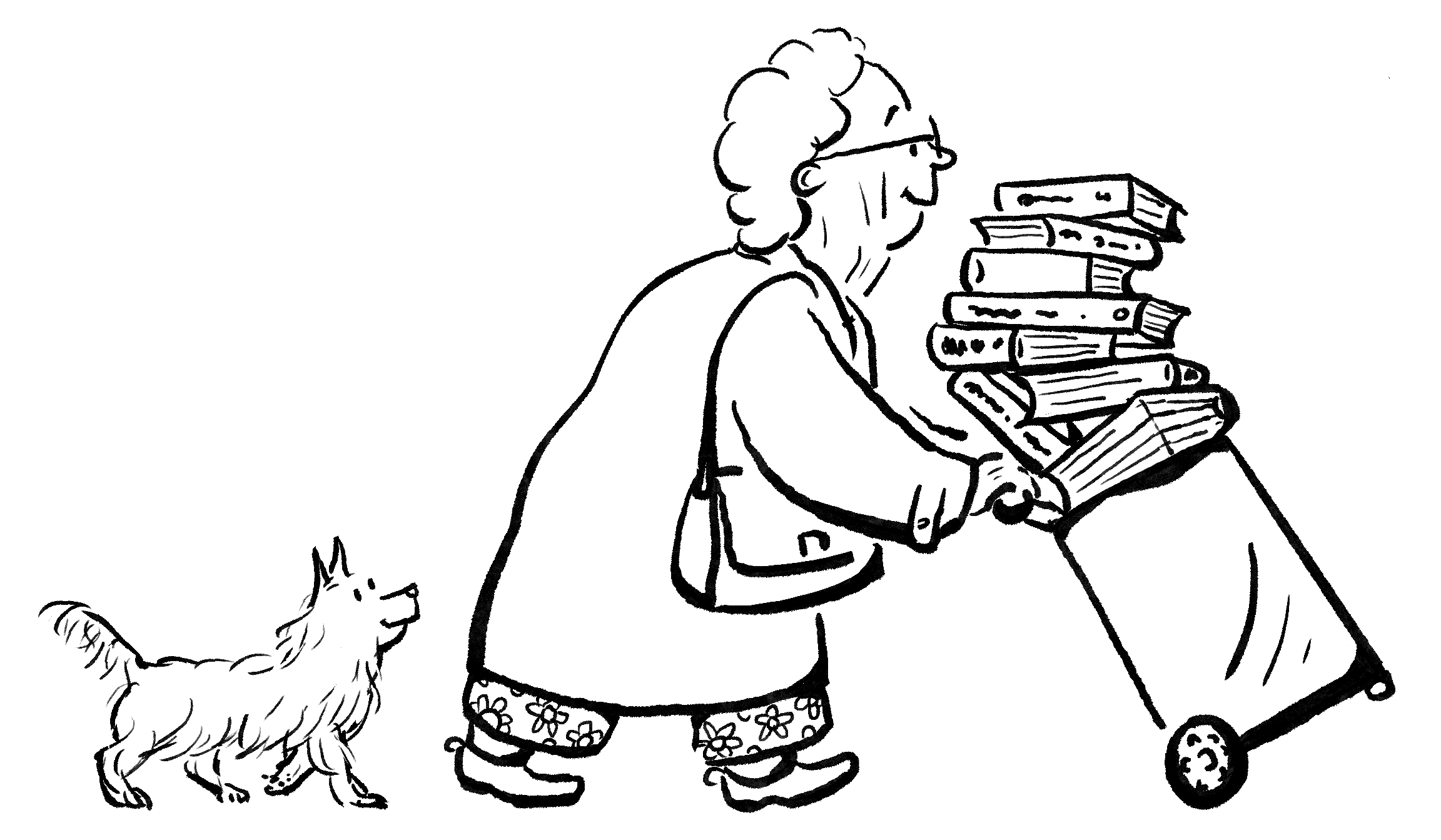



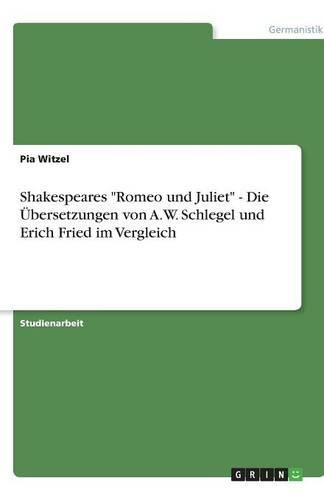
Studienarbeit aus dem Jahr 2001 im Fachbereich Germanistik - Linguistik, Note: 1,0, Heinrich-Heine-Universitat Dusseldorf (Abteilung fur germanistische Sprachwissenschaft), Veranstaltung: Germanistisches Seminar: UEbersetzungstheorie und -geschichte, 15 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Einleitung In der vorliegenden Arbeit sollen die UEbersetzungen von Shakespeares Romeo and Juliet1 Erich Frieds2 und August Wilhelm von Schlegels3 anhand ausgesuchter Textstellen untersucht werden. Das Stuck wurde vermutlich erstmals 1596 aufgefuhrt. Die Auswahl der UEbersetzungen ist willkurlich und darf nicht zu dem Fehlschluss fuhren, in der Zwischenzeit von Schlegels bis Frieds UEbersetzung seien keine, oder nur wenige unbedeutende Versuche unternommen worden, seine Stucke ins Deutsche zu ubertragen. Zu den beruhmtesten Shakespeare-UEbersetzern zahlen Bodmer, Lessing, Wieland und Eschenburg. Selbst Goethe, weniger als UEbersetzer als als Dichter und Dramenschreiber bekannt, versuchte sich an einer Bearbeitung von Romeo und Julia. Bei den exemplarisch untersuchten Textstellen handelt es sich um eine prosaische Stelle (1.1.1-69)4, zwei Textstellen im Blankvers sowie eine Textstelle mit festem Reimschema (1.5.93-110). Hierzu sollen verglichen werden: zum einen formale Aspekte der UEbersetzungen wie Versmass und Reim, lautliche UEbereinstimmungen, Syntax als auch formal bedingte Auslassungen und Zusatze; zum anderen semantische Aspekte der UEbersetzungen wie z.B. Wortspiele, Anstoessiges, sowie deutende bzw. erklarende Veranderungen der UEbersetzer. Folgend aus den beobachteten Unterschieden und Gemeinsamkeiten soll auf den ubersetzungstheoretischen Hintergrund des jeweiligen UEbersetzers ruckgeschlossen werden. Die Poetik der beiden UEbersetzer ist weitestgehend aus den UEbersetzungen, also immanent, zu erarbeiten. Als letzter Schritt soll die Bezugnahme auf die im Seminar UEbersetzungstheorie und - geschichte besproche
$9.00 standard shipping within Australia
FREE standard shipping within Australia for orders over $100.00
Express & International shipping calculated at checkout
Stock availability can be subject to change without notice. We recommend calling the shop or contacting our online team to check availability of low stock items. Please see our Shopping Online page for more details.
Studienarbeit aus dem Jahr 2001 im Fachbereich Germanistik - Linguistik, Note: 1,0, Heinrich-Heine-Universitat Dusseldorf (Abteilung fur germanistische Sprachwissenschaft), Veranstaltung: Germanistisches Seminar: UEbersetzungstheorie und -geschichte, 15 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Einleitung In der vorliegenden Arbeit sollen die UEbersetzungen von Shakespeares Romeo and Juliet1 Erich Frieds2 und August Wilhelm von Schlegels3 anhand ausgesuchter Textstellen untersucht werden. Das Stuck wurde vermutlich erstmals 1596 aufgefuhrt. Die Auswahl der UEbersetzungen ist willkurlich und darf nicht zu dem Fehlschluss fuhren, in der Zwischenzeit von Schlegels bis Frieds UEbersetzung seien keine, oder nur wenige unbedeutende Versuche unternommen worden, seine Stucke ins Deutsche zu ubertragen. Zu den beruhmtesten Shakespeare-UEbersetzern zahlen Bodmer, Lessing, Wieland und Eschenburg. Selbst Goethe, weniger als UEbersetzer als als Dichter und Dramenschreiber bekannt, versuchte sich an einer Bearbeitung von Romeo und Julia. Bei den exemplarisch untersuchten Textstellen handelt es sich um eine prosaische Stelle (1.1.1-69)4, zwei Textstellen im Blankvers sowie eine Textstelle mit festem Reimschema (1.5.93-110). Hierzu sollen verglichen werden: zum einen formale Aspekte der UEbersetzungen wie Versmass und Reim, lautliche UEbereinstimmungen, Syntax als auch formal bedingte Auslassungen und Zusatze; zum anderen semantische Aspekte der UEbersetzungen wie z.B. Wortspiele, Anstoessiges, sowie deutende bzw. erklarende Veranderungen der UEbersetzer. Folgend aus den beobachteten Unterschieden und Gemeinsamkeiten soll auf den ubersetzungstheoretischen Hintergrund des jeweiligen UEbersetzers ruckgeschlossen werden. Die Poetik der beiden UEbersetzer ist weitestgehend aus den UEbersetzungen, also immanent, zu erarbeiten. Als letzter Schritt soll die Bezugnahme auf die im Seminar UEbersetzungstheorie und - geschichte besproche