Readings Newsletter
Become a Readings Member to make your shopping experience even easier.
Sign in or sign up for free!
You’re not far away from qualifying for FREE standard shipping within Australia
You’ve qualified for FREE standard shipping within Australia
The cart is loading…

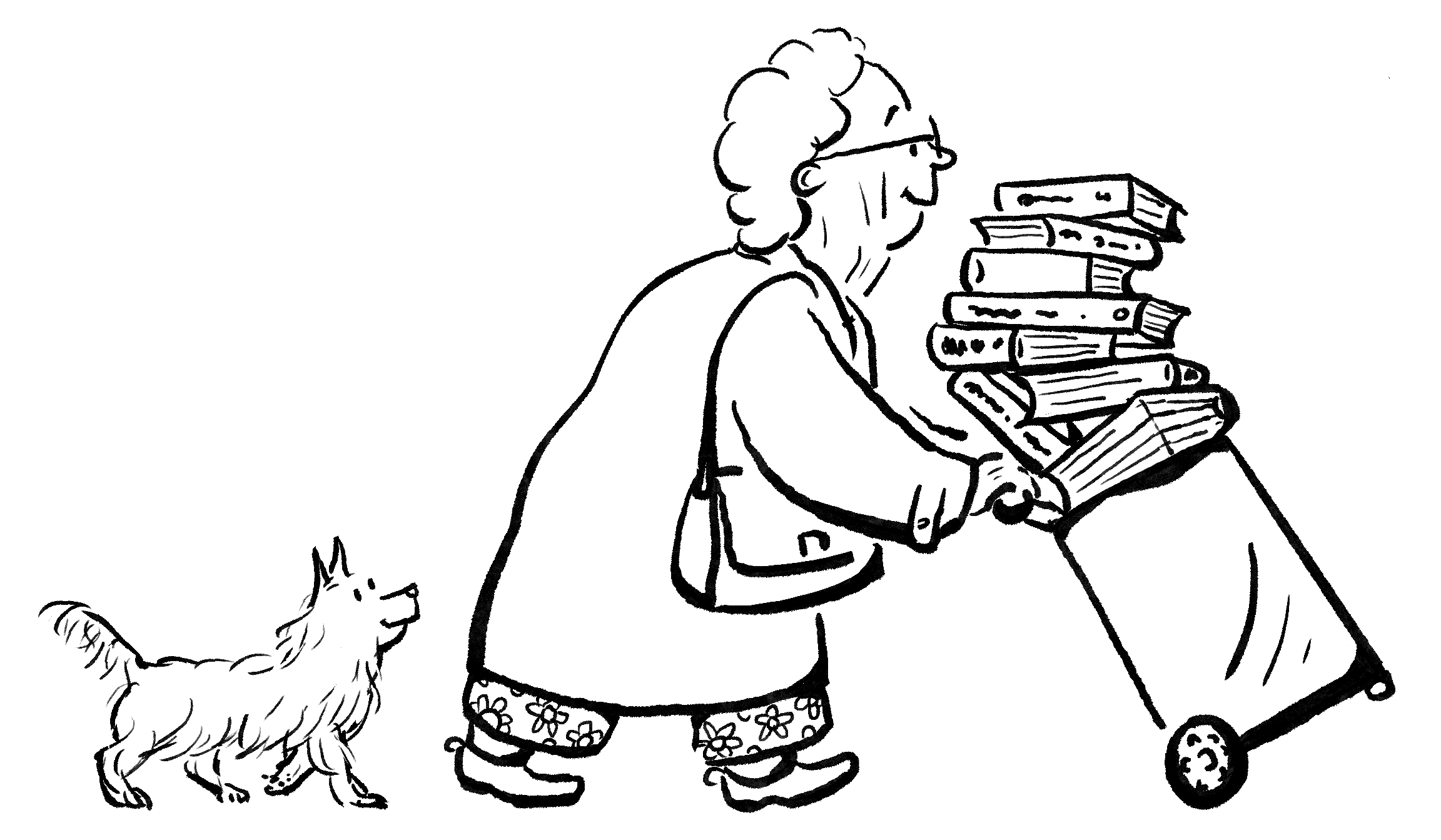



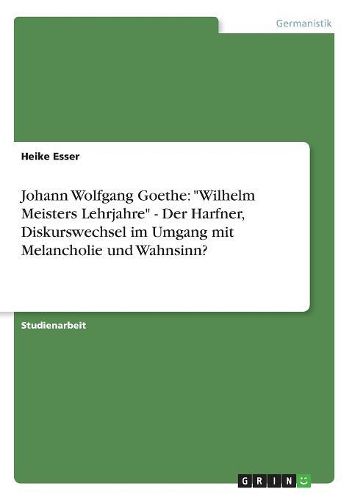
Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: 2,0, Universitat Trier (Neuere deutsche Literatur), Veranstaltung: Goethes Lehr- und Wanderjahre, 14 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Anmerkungen: Kommentar der Dozentin: Eine gute und klare Darstellung., Abstract: Diese Arbeit setzt sich mit der erst in der jungeren Forschung aufgeworfenen Frage auseinander, ob Goethes Lehrjahre einen Diskurswechsel im Umgang mit Melancholie und Wahnsinn beschreiben, und konzentriert sich dabei auf die Darstellung der Harfner-Figur. Wie ein roter Faden durchziehen Melancholie und Wahnsinn den Roman, denn so verschiedene Figuren wie Laertes, der Graf und die Grafin, Aurelie, Mignon, Sperata und der Harfner leiden unter melancholischen Anfallen, die sich im Falle des Harfners bis in eine Eskalation des Wahnsinns steigern. In der Krankheits- und Heilungsgeschichte des Harfners wird eine Veranderung im Umgang mit Melancholie und Wahnsinn besonders deutlich, denn bei ihm lasst sich die Entwicklung von einem melancholischen Gemutszustand uber den ausbrechenden Wahnsinn bis hin zur Therapie verfolgen. In Anlehnung an die Lebensgeschichte des Harfners teilt sich diese Arbeit in zwei Teile. Im ersten Teil stehen die europaische Melancholietradition und der Genie-Gedanke des Sturm und Drangs im Fokus und zwar im Hinblick darauf, wie und warum Goethe beides in seine Darstellung des Harfners hat einflieen lassen. Des Weiteren wird dessen Krankheitsgeschichte analysiert. Im zweiten Teil steht die Therapie des Harfners im Mittelpunkt. Der medizinische Diskurs der Melancholie und des Wahnsinns am Ende des 18. Jahrhunderts und Goethes Verhaltnis zu diesem wird vorgestellt und mit der Therapie und den Therapiemanahmen am Harfner verglichen. In dieser Arbeit wird nachgewiesen, dass Goethe sowohl mit der europaischen Melancholietradition als auch mit den zeitgenossischen medizinischen und psychologischen Diskursen vertraut war u
$9.00 standard shipping within Australia
FREE standard shipping within Australia for orders over $100.00
Express & International shipping calculated at checkout
Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: 2,0, Universitat Trier (Neuere deutsche Literatur), Veranstaltung: Goethes Lehr- und Wanderjahre, 14 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Anmerkungen: Kommentar der Dozentin: Eine gute und klare Darstellung., Abstract: Diese Arbeit setzt sich mit der erst in der jungeren Forschung aufgeworfenen Frage auseinander, ob Goethes Lehrjahre einen Diskurswechsel im Umgang mit Melancholie und Wahnsinn beschreiben, und konzentriert sich dabei auf die Darstellung der Harfner-Figur. Wie ein roter Faden durchziehen Melancholie und Wahnsinn den Roman, denn so verschiedene Figuren wie Laertes, der Graf und die Grafin, Aurelie, Mignon, Sperata und der Harfner leiden unter melancholischen Anfallen, die sich im Falle des Harfners bis in eine Eskalation des Wahnsinns steigern. In der Krankheits- und Heilungsgeschichte des Harfners wird eine Veranderung im Umgang mit Melancholie und Wahnsinn besonders deutlich, denn bei ihm lasst sich die Entwicklung von einem melancholischen Gemutszustand uber den ausbrechenden Wahnsinn bis hin zur Therapie verfolgen. In Anlehnung an die Lebensgeschichte des Harfners teilt sich diese Arbeit in zwei Teile. Im ersten Teil stehen die europaische Melancholietradition und der Genie-Gedanke des Sturm und Drangs im Fokus und zwar im Hinblick darauf, wie und warum Goethe beides in seine Darstellung des Harfners hat einflieen lassen. Des Weiteren wird dessen Krankheitsgeschichte analysiert. Im zweiten Teil steht die Therapie des Harfners im Mittelpunkt. Der medizinische Diskurs der Melancholie und des Wahnsinns am Ende des 18. Jahrhunderts und Goethes Verhaltnis zu diesem wird vorgestellt und mit der Therapie und den Therapiemanahmen am Harfner verglichen. In dieser Arbeit wird nachgewiesen, dass Goethe sowohl mit der europaischen Melancholietradition als auch mit den zeitgenossischen medizinischen und psychologischen Diskursen vertraut war u