Readings Newsletter
Become a Readings Member to make your shopping experience even easier.
Sign in or sign up for free!
You’re not far away from qualifying for FREE standard shipping within Australia
You’ve qualified for FREE standard shipping within Australia
The cart is loading…

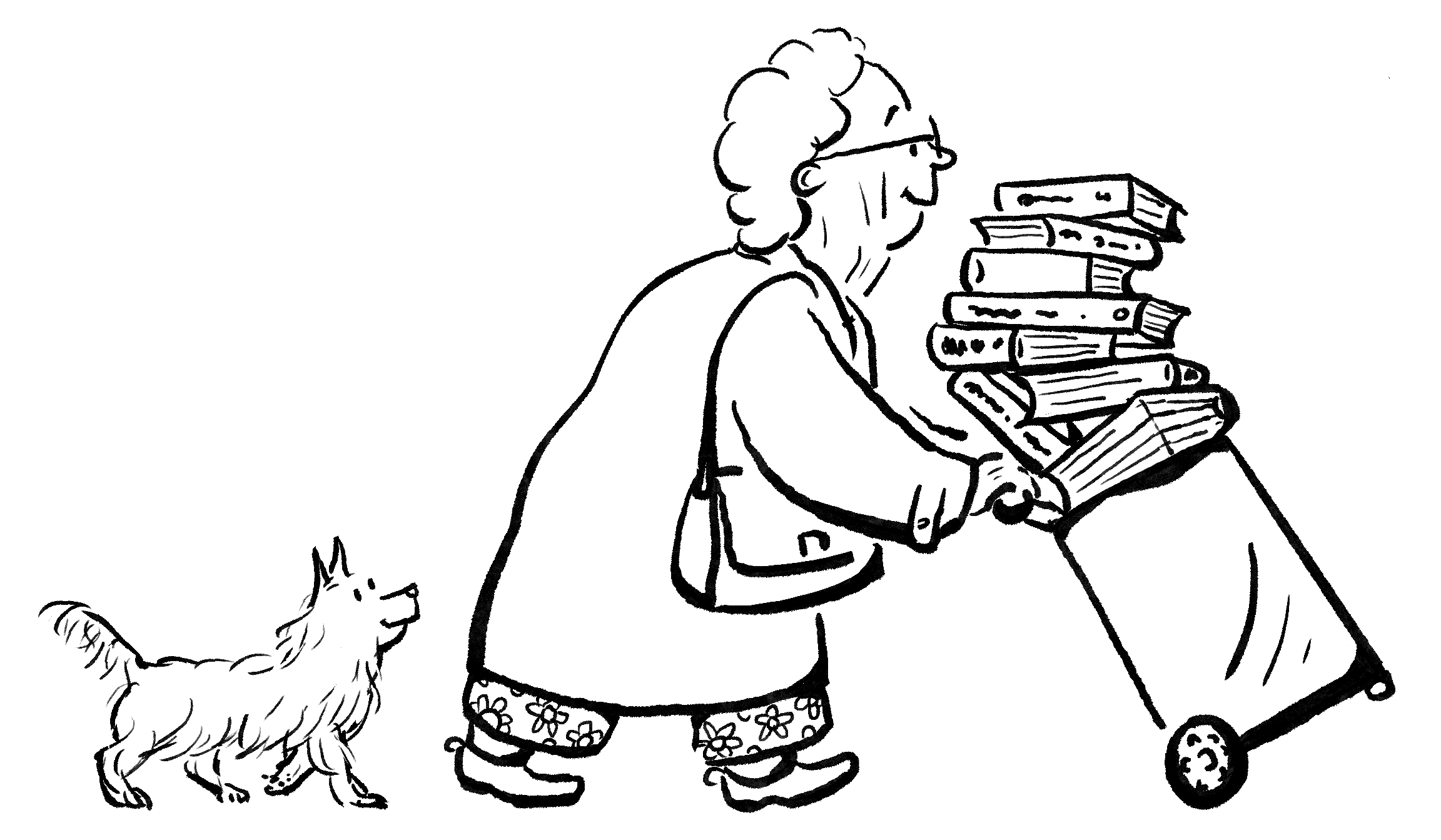



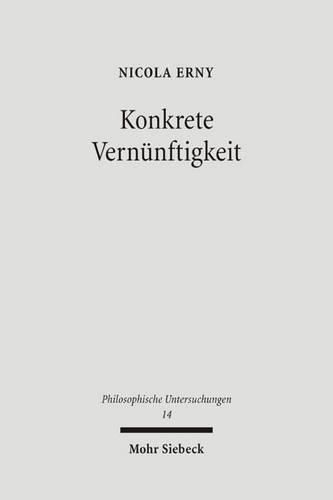
Charles S. Peirce (1839-1914) ist in erster Linie bekannt als Begrunder des modernen Pragmatismus und fur seine Untersuchungen zur Semiotik, Logik und Erkenntnistheorie. Bisher gibt es allerdings keine zusammenhangende Analyse und Darstellung der Konzeption der Ethik des Begrunders des Pragmatismus. Tatsachlich hat der fruhe Peirce die Ethik als eigene philosophische Disziplin abgelehnt. Doch ab etwa 1902 bemuhte er sich um eine pragmatistische Begrundung der normativen Wissenschaften AEsthetik, Ethik und Logik. In dieser Arbeit analysiert Nicola Erny die systematische Relevanz und die theoretischen Begrundungsansatze der Peirceschen Ethikkonzeption. Ergebnisse: In Analogie zu der erkenntnistheoretischen Konstruktion einer finalen konsensualen Aussage konstruiert Peirce das moralische Fernziel ( summum bonum) keineswegs als finalen Abschluss des moralischen Fortschritts. Es handelt sich um ein dynamisches Prinzip, das, ohne inhaltliche Festlegung, das Ideal konkreter Vernunftigkeit darstellt. Insoweit markiert das summum bonum einen idealen Grenzwert, auf den hin sich gemass Peirce das moralische Handeln in einem geschichtlichen Prozess zunehmender Konkretisierung der Vernunftigkeit ( reasonableness) zubewegt.
$9.00 standard shipping within Australia
FREE standard shipping within Australia for orders over $100.00
Express & International shipping calculated at checkout
Charles S. Peirce (1839-1914) ist in erster Linie bekannt als Begrunder des modernen Pragmatismus und fur seine Untersuchungen zur Semiotik, Logik und Erkenntnistheorie. Bisher gibt es allerdings keine zusammenhangende Analyse und Darstellung der Konzeption der Ethik des Begrunders des Pragmatismus. Tatsachlich hat der fruhe Peirce die Ethik als eigene philosophische Disziplin abgelehnt. Doch ab etwa 1902 bemuhte er sich um eine pragmatistische Begrundung der normativen Wissenschaften AEsthetik, Ethik und Logik. In dieser Arbeit analysiert Nicola Erny die systematische Relevanz und die theoretischen Begrundungsansatze der Peirceschen Ethikkonzeption. Ergebnisse: In Analogie zu der erkenntnistheoretischen Konstruktion einer finalen konsensualen Aussage konstruiert Peirce das moralische Fernziel ( summum bonum) keineswegs als finalen Abschluss des moralischen Fortschritts. Es handelt sich um ein dynamisches Prinzip, das, ohne inhaltliche Festlegung, das Ideal konkreter Vernunftigkeit darstellt. Insoweit markiert das summum bonum einen idealen Grenzwert, auf den hin sich gemass Peirce das moralische Handeln in einem geschichtlichen Prozess zunehmender Konkretisierung der Vernunftigkeit ( reasonableness) zubewegt.