Readings Newsletter
Become a Readings Member to make your shopping experience even easier.
Sign in or sign up for free!
You’re not far away from qualifying for FREE standard shipping within Australia
You’ve qualified for FREE standard shipping within Australia
The cart is loading…

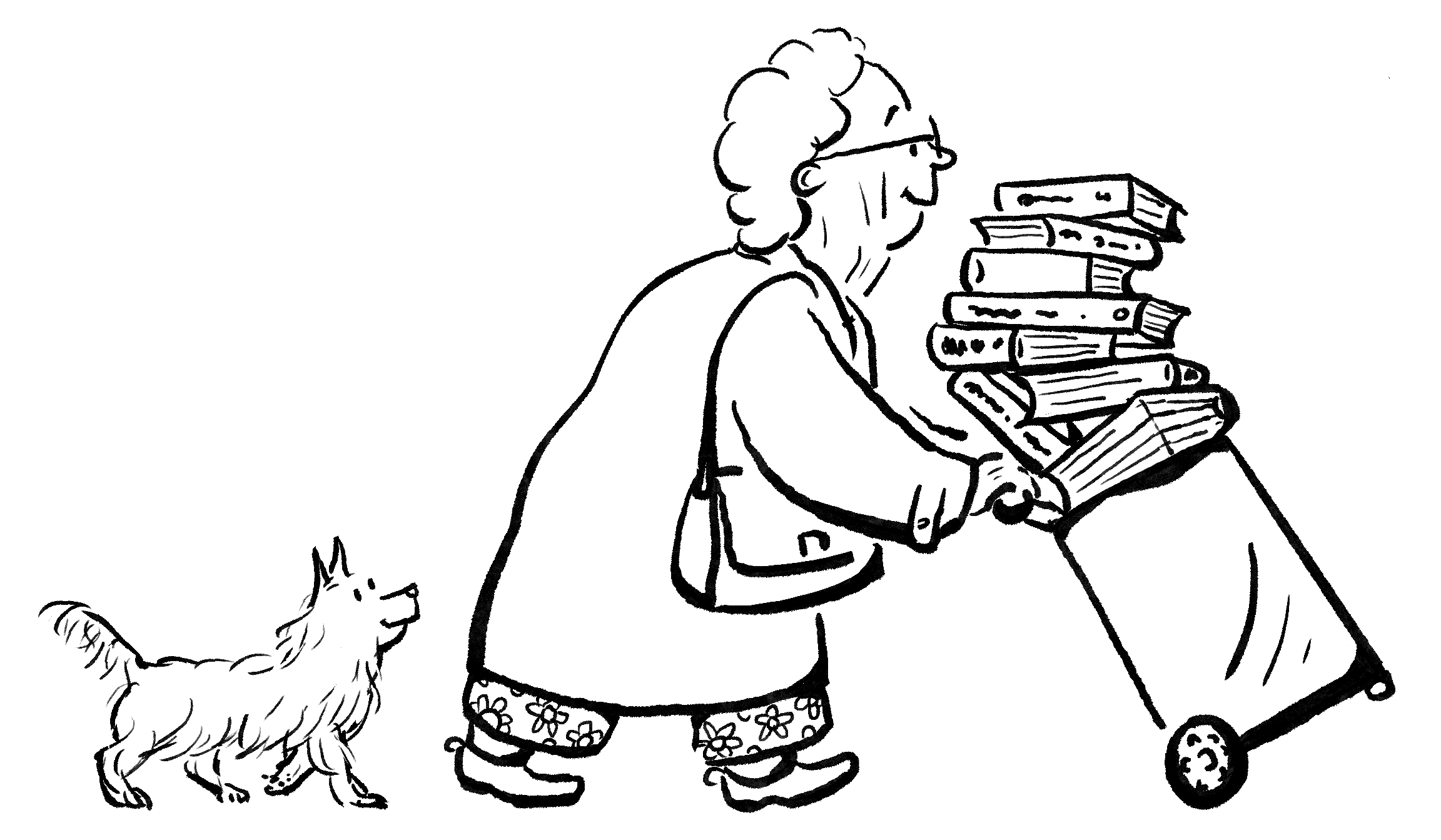



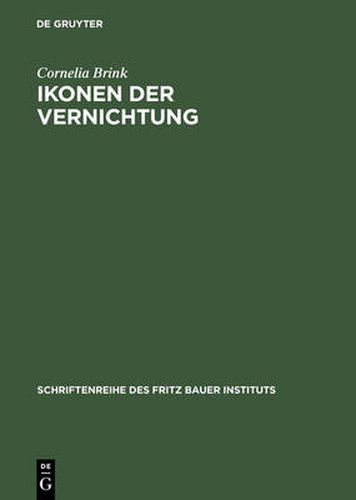
This title is printed to order. This book may have been self-published. If so, we cannot guarantee the quality of the content. In the main most books will have gone through the editing process however some may not. We therefore suggest that you be aware of this before ordering this book. If in doubt check either the author or publisher’s details as we are unable to accept any returns unless they are faulty. Please contact us if you have any questions.
Unmittelbar nach der Befreiung der nationalsozialistischen Konzentrationslager im Fruhjahr 1945 entstanden Fotografien, die Berge von Leichen zeigen, Massengraber, halbverhungerte UEberlebende auf Pritschen oder hinter Stacheldraht. Seit ihrer ersten Veroeffentlichugn sind diese Aufnahmen Bestandteil einer oeffentlichen Erinnerungskultur in der Bundesrepublik Deutschland geworden. Zu Schreckensbildern erstarrt, stehen sie als Ikonen der Vernichtung fur die Unmemnschlichkeit des NS-Regimes. Der Begriff der Ikone liefert einen Schlussel zum Verstandnis der Kontexte, in denen diese Fotos aufgenommen, publiziert und betrachtet worden sind. Analog zu den religioesen Kultbildern gelten die Aufnahmen als authentisch, sie sind von hoher Symbolisierungkraft. Der Umgang mit den Fotos mutet ritualisiert an. Man schaut sie an und meint zu wissen, wofur sie stehen. Um die Fotografien der Lager aus ihrer Erstarrung zu loesen, die alles weitere Nachdenken uber das Abgebildete zu erubrigen scheint, richtet das Buch von Cornelia Brink erstmals einen genauen Blick auf die Bilder. Die KZ-Fotografien liefern nicht nur einen Schlussel zu der Zeit, aus der sie stammen, sondern auch zur (Verdrangungs-)Geschichte, die auf sie folgte. Die Studie verknupft daher fotohistorische und -theoretische Fragen mit der Problematik oeffentlich wirksamer Formen der Erinnerung an die Nationalsozialistische Vergangenheit. Sie zeigt, was verschiedene Institutionen in der Bundesrepublik Deutschland - alliierte Besatzungsmachte, Juristen, Publizisten, Padagogen und Ausstellungsmacher - seit 1945 bis in die Gegenwart mit den Ikonen der Vernichtung angefangen haben.
$9.00 standard shipping within Australia
FREE standard shipping within Australia for orders over $100.00
Express & International shipping calculated at checkout
Stock availability can be subject to change without notice. We recommend calling the shop or contacting our online team to check availability of low stock items. Please see our Shopping Online page for more details.
This title is printed to order. This book may have been self-published. If so, we cannot guarantee the quality of the content. In the main most books will have gone through the editing process however some may not. We therefore suggest that you be aware of this before ordering this book. If in doubt check either the author or publisher’s details as we are unable to accept any returns unless they are faulty. Please contact us if you have any questions.
Unmittelbar nach der Befreiung der nationalsozialistischen Konzentrationslager im Fruhjahr 1945 entstanden Fotografien, die Berge von Leichen zeigen, Massengraber, halbverhungerte UEberlebende auf Pritschen oder hinter Stacheldraht. Seit ihrer ersten Veroeffentlichugn sind diese Aufnahmen Bestandteil einer oeffentlichen Erinnerungskultur in der Bundesrepublik Deutschland geworden. Zu Schreckensbildern erstarrt, stehen sie als Ikonen der Vernichtung fur die Unmemnschlichkeit des NS-Regimes. Der Begriff der Ikone liefert einen Schlussel zum Verstandnis der Kontexte, in denen diese Fotos aufgenommen, publiziert und betrachtet worden sind. Analog zu den religioesen Kultbildern gelten die Aufnahmen als authentisch, sie sind von hoher Symbolisierungkraft. Der Umgang mit den Fotos mutet ritualisiert an. Man schaut sie an und meint zu wissen, wofur sie stehen. Um die Fotografien der Lager aus ihrer Erstarrung zu loesen, die alles weitere Nachdenken uber das Abgebildete zu erubrigen scheint, richtet das Buch von Cornelia Brink erstmals einen genauen Blick auf die Bilder. Die KZ-Fotografien liefern nicht nur einen Schlussel zu der Zeit, aus der sie stammen, sondern auch zur (Verdrangungs-)Geschichte, die auf sie folgte. Die Studie verknupft daher fotohistorische und -theoretische Fragen mit der Problematik oeffentlich wirksamer Formen der Erinnerung an die Nationalsozialistische Vergangenheit. Sie zeigt, was verschiedene Institutionen in der Bundesrepublik Deutschland - alliierte Besatzungsmachte, Juristen, Publizisten, Padagogen und Ausstellungsmacher - seit 1945 bis in die Gegenwart mit den Ikonen der Vernichtung angefangen haben.